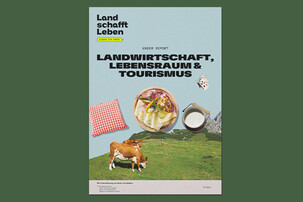Wie Österreich zum Tourismus-Land wurde
Das Reisen war lange Zeit ein Privileg weniger Menschen. Die Alpen galten dabei eher als Ort des Schreckens und als Hindernis auf dem Weg Richtung Süden. Dies änderte sich erst durch die Reiseberichte der „ersten Influencer“ der Romantik. Sie stellten vor allem den Kontrast aus wilder, schroffer Bergwelt und der vermeintlichen Idylle der Almen in den Mittelpunkt. Von ihm wurden nach und nach mehr Menschen angezogen.
Lange Zeit galten die Alpen, und damit auch große Teile des heutigen Österreichs, als Ort des Schreckens. Laut des römischen Geschichtsschreibers Titus Livius lebten in den von Eis und Schnee geprägten Bergen „wilde, ungepflegte Menschen“ in „armseligen Hütten auf Felsen“. Ihre Herden seien „vor Kälte verkrüppelt und verkümmert“ gewesen. Über die Alpenüberquerung des Karthagers Hannibal im Jahr 218 vor Christus schreibt Livius: „Der Anblick der Alpen weckte die schlimmsten Ängste in den Köpfen seiner Männer.“ Diese römische Sichtweise auf die Alpen hat die Vorstellungen in ganz Europa geprägt und sich bis Ende des 18. Jahrhunderts kaum verändert.
Erst im Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert setzte sich in weiten Teilen der Bevölkerung allmählich eine neue, entscheidende Weltsicht durch: Statt allein auf Glauben beziehungsweise Aberglauben zu vertrauen, wurden althergebrachte Erklärungen und Sichtweisen nun zunehmend infrage gestellt. Dies zeigte sich auch in einem wachsenden Bestreben, die Natur zu erforschen.
Als Folge richteten Forscher, Entdecker und Abenteurer ihren Blick auch auf die Alpen. Meilensteine dieser Zeit waren etwa die Erstbesteigungen hoher Alpengipfel, etwa des Mont Blanc am 8. August 1786. Sie gilt gleichzeitig als der Beginn des modernen Alpinismus, sprich des Bergsteigens und Bergwanderns. Der Großglockner, der höchste Berg im heutigen Österreich, wurde erstmals auf Betreiben des Kärntner Fürstbischofs Franz Xaver Salm-Reifferscheidt am 28. Juli des Jahres 1800 bestiegen.
Kulturlandschaft und Berge im romantisch-verklärten Blick der „ersten Influencer“

Die kulturgeschichtliche Epoche der Romantik fügte der rationalen Sichtweise der Wissenschaft den gefühlsbetonten Blick hinzu. Kunstschaffende thematisierten nun individuelle Emotionen, Leidenschaft und seelisches Erleben. Ihre Werke ließen Landschaften, ganz besonders die Alpen, nun als ästhetische und emotionale Sehnsuchtsorte erscheinen. Erste Reiseberichte, Gedichte und Gemälde schwärmten von der Erhabenheit der Gipfel, von der wilden Schönheit der Landschaft sowie von der Ursprünglichkeit des Lebens in den Bergen. Solche Berichte stießen auf großes Interesse bei europäischem Adel und Bürgertum.
Nach ihrer Besteigung des Schafbergs im Salzkammergut schwärmte etwa die deutsche Journalistin und Dichterin Helmine von Chezy im Jahr 1833: „O, welch ein Bild lohnte unsern Muth! – Schweigend lag die Welt unter uns, schon in nächtliches DunkeI verhüllt, nur zwei breite lichtere Streifen im Kreise herum, bezeichneten die stillen Flächen des Atter-, Mond- und Wolfgangsees.“
Tourismusforscherin Theresa Mitterer-Leitner bezeichnet die Verfasserinnen und Verfasser solcher Berichte als die „ersten Influencer“. Zu ihnen gehörten auch bekannte Namen wie Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und später etwa Mark Twain. „Es gibt sehr, sehr viele berühmte Werke, die ein schwärmerisches Bild über die Berge zeichnen und damit eine echte Zeitenwende einleiten“, erklärt die Wissenschaftlerin. Diese neuen Berichte zeichneten oftmals ein ebenso wenig realistisches Zerrbild wie zuvor die römischen Schreckensberichte, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen.
In den Werken aus Literatur und Malerei ist ein durchgängiges Prinzip erkennbar: Der Reiz der Alpen lebt vom Zusammenwirken zwischen Idylle und Bedrohlichem. „Das Auffällige ist, dass es nicht nur die reine Bergwelt war, die da beschrieben oder gemalt wurde“, erläutert Tourismusexpertin Theresa Mitterer-Leitner. „Stattdessen war die Darstellung der Alpen von Anfang an mit der Kulturlandschaft verbunden. Es war genau der Kontrast zwischen schroffer, eisbedeckter Bergwelt einerseits und den lieblichen Landschaftsausschnitten andererseits, der den Reiz ausmachte. Vor allem die Ruhe und Geborgenheit ausstrahlenden Almen, wo die Tiere friedlich neben einer Hütte grasen, stehen aus Sicht der gewissermaßen verklärten Städter für die idyllische, alpenländische Lebensweise.“
Bergsteigen, Kurorte und Sommerfrische

Zu den Grundvoraussetzungen der Entwicklung des Tourismus gehört die Industrialisierung. Sie brachte mit wachsenden Städten und einer veränderten Arbeitswelt einen Bedarf an Erholung, aber auch die Möglichkeit, diese abseits des Wohnortes zu finden. So wurde das Eisenbahnnetz in der Mitte des 19. Jahrhunderts massiv ausgebaut. Auch die Dampfschifffahrt beschleunigte und verbilligte das Reisen.
In Österreich entwickelte sich der Tourismus mit seiner eigenen Infrastruktur vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Laut Theresa Mitterer-Leitner waren in dieser Zeit zwei Faktoren besonders prägend: Auf der einen Seite die angenommenen gesundheitlichen Wirkungen von Luft, Sonne, Salzwasser oder Sand, auf der anderen Seite das „Naturerlebnis“ beziehungsweise die körperlich-sportliche Betätigung durch Wandern und Bergsteigen, gegen Ende des Jahrhunderts auch durch das Skifahren.
Als erste touristische Hotspots etablierten sich zum Beispiel Kurorte wie Bad Gastein oder Bad Ischl. Letzterer wurde auch dadurch gefördert, dass die kaiserliche Familie dort über Jahrzehnte hinweg ihre Sommerfrische verbrachte.
Speziell das etwas weniger zahlungskräftige Publikum aus mittleren Beamten, Angestellten oder Geschäftsleuten verbrachte die Sommerfrische gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch auf Bauernhöfen. Dazu räumten die Bauernfamilien oftmals ihren eigenen Wohnbereich und wichen auf andere Räumlichkeiten des Bauernhofs aus. Laut Mitterer-Leitner wurde diese Form des Reisens aber keinesfalls als Urlaub zweiter Wahl wahrgenommen, ganz im Gegenteil. „Gerade in Verbindung mit dem Begriff Sommerfrische suchte man das einfache Landleben: Gemütlichkeit, Geborgenheit und – vor allem für die Kinder – die gesunde Umgebung jenseits der verdreckten Städte“, erklärt die Tourismus-Forscherin. „Die Sommerfrische war ab Ende des 19. Jahrhunderts stark mit monatelangen Aufenthalten am Land verbunden.“
Diese frühe Form des „Urlaubs auf dem Bauernhof“ diente nicht zuletzt auch Künstlern und Literatinnen als zum Teil schaffensreicher Rückzugsort. Einer der typischen Sommerfrische-Orte war Bad Aussee im steirischen Salzkammergut. Dort residierten zwischen Juni und September zwar auch Persönlichkeiten wie der deutsche Reichkanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst in ihren eigens erbauten Seehäusern, aber drumherum wohnten auch junge Künstler und andere, weniger wohlhabende Menschen. Für die bäuerliche und in bescheidenen Verhältnissen lebende Bevölkerung bedeuteten die Sommerfrischler Verdienstmöglichkeiten, die man sich nicht entgehen lassen wollte oder konnte.
Nach Aussee kam unter anderem auch der Wiener Schriftsteller und Mitbegründer der Salzburger Festspiele Hugo von Hoffmannsthal mit seiner Familie regelmäßig. In seiner Erzählung „Das Dorf im Gebirge“ setzt er dieser frühen Verbindung aus Landwirtschaft und Tourismus fast eine Art Denkmal:
„Im Juni sind die Leute aus der Stadt gekommen und wohnen in allen großen Stuben. Die Bauern und ihre Weiber schlafen in den Dachkammern, die voll alten Pferdegeschirrs hängen (…). Sie haben aus den unteren Stuben alle ihre Sachen weggetragen und alle Truhen für die Stadtleute freigemacht, und nichts ist in den Stuben zurückgeblieben als der Geruch von Keller mit großen Rahmeimern und altem Holz (…).“
Die touristische Form der Sommerfrische erlebte um das Jahr 1900 herum einen Höhepunkt. Laut Tourismusforscherin Mitterer-Leitner war diese Form des Tourismus aber auch noch in den 1950er- und 60er-Jahren ein großes Thema. „Man kann natürlich darüber diskutieren, ab wann die Sommerfrische zum normalen Sommerurlaub wurde. Die Aufenthaltsdauern verkürzten sich sicher nach dem Zweiten Weltkrieg. Was aber blieb, ist die Bedeutung der Bauernhöfe als Unterkunftsgeber.“ Allerdings kam es nach und nach weniger häufig vor, dass die Bauernfamilien ihre eigenen Zimmer den Gästen überließen. Stattdessen schuf man jetzt eigene „Fremdenzimmer“ auf den Höfen.
Der Alpenverein und die Almen
Der älteste und heute größte alpine Verein des Landes ist der „Österreichische Alpenverein“ (ÖAV). Er wurde am 19. November 1862 auf Betreiben dreier Studenten in Wien gegründet. Er war damit nach dem britischen Alpine Club der zweite seiner Art weltweit. Eine der selbst auferlegten Aufgaben des Vereins bestand vor allem darin, jene Pfade und Wege auszubauen, die durch die Landwirtschaft im bergigen Gelände bereits angelegt worden waren. Aber auch die Neuschaffung von Wanderwegen und Klettersteigen gehörte dazu.
Vor allem haben die Alpenvereine den Bau von teils massiven, steinernen Schutzhütten vorangetrieben und dadurch für relativ komfortable Übernachtungsmöglichkeiten im Hochgebirge gesorgt. Durch den Hüttenbau trugen die alpinen Vereine wesentlich dazu bei, die Berge zugänglich und erlebbar zu machen – auch für weniger hart gesottene Menschen.
Schutzhütten in Nähe der Alm? Wie komfortabel darf es sein?
Allerdings gab es schon in den Anfangszeiten des Alpenvereins Diskussionen darüber, inwieweit das Bergwandern überhaupt bequemer werden sollte, wie weit also die Attraktivität und Zugänglichkeit für immer größere Kreise der Bevölkerung gesteigert werden dürfe. Martin Achrainer betreut das historische Archiv des Österreichischen Alpenvereins in Innsbruck und kennt die frühen Auseinandersetzungen innerhalb des Vereins. Zum Beispiel jene um den Bau der Erzherzog-Rainer-Hütte am Wasserfallboden im Kapruner Tal (Salzburger Land). Sie wurde 1868 als erste Schutzhütte des Österreichischen Alpenvereins fertiggestellt. „Die Rainer-Hütte wurde in Steinwurfweite von bestehenden Almhütten gebaut, damit die Versorgung der Wanderer mit Milch, Butter und Roggenbrot gesichert ist“, erklärt Martin Achrainer. „Das ist dann aber von Teilen des Alpenvereins sehr scharf kritisiert worden. Die haben argumentiert: Wenn eh schon eine Almhütte da ist, dann genügt das ja, dann sollen die Leute dort am Heuboden schlafen.“
Dennoch wurden viele Schutzhütten in der Nähe von Almen gebaut, wodurch beide Seiten profitierten. Sofern die neuen Hütten auf dem Grund von Almen oder Gemeinschaftsalmen gebaut wurden, hätten sich die Grundbesitzer meist ausverhandelt, dass Milch und Butter von der Alm bezogen werden mussten. Dies sei laut Achrainer zu Beginn sehr wichtig gewesen.
Rinder vor der Rainerhütte am Wasserfallboden im Kapruner Tal (ca. 1900-1915)
„Dadurch haben die Almen profitiert, weil sie ihre Produkte zum Verkaufen nicht ins Tal bringen mussten. Gleichzeitig haben es sich die Schutzhütten erspart, Lebensmittel aus dem Tal hinaufzuschleppen.”
links: Zwei Bäuerinnen beim Butterstampfen, unbekannter Ort (um 1910)
rechts: Wandergäste vor der Rainerhütte am Wasserfallboden im Kapruner Tal (3. August 1899)