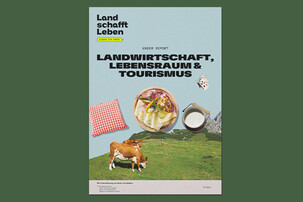Lebensraum Alm
Almen sind nicht nur ein zentrales Wesensmerkmal der Kulturgeschichte Österreichs und Rückgrat des Tourismus. Sie erfüllen viele weitere Funktionen. So sind sie ein Hort der Biodiversität, gut für unser Trinkwasser und verkleinern das Risiko von Naturgefahren. Vieles spricht dafür, Almen auch weiterhin zu bewirtschaften und ihre großflächige Umwandlung in Wald zu verhindern.

Eine Alm ist dem Wortsinn nach eine Weide auf einem Berg. Oder, in einem Wort gesagt: eine Bergweide. Auch wenn wir beim Wandern durch Almgebiete häufig von der „schönen Natur“ sprechen, spiegelt sich darin im Grunde eine falsche Sichtweise wider. Almen sind Kultur-Landschaften, die von Menschen in der Regel schon vor Jahrhunderten oder länger durch die Rodung von Wäldern angelegt wurden. Sie blieben nur aufgrund regelmäßiger Beweidung durch Nutztiere bis heute bestehen. Ohne diese Beweidung oder das Mähen zur Heugewinnung würden die meisten Almen wieder zu dem werden, was sie einst waren: Wälder. Viele ihrer Funktionen gingen dadurch verloren.
So kann man Almen innerhalb Österreichs als Hort der Biodiversität bezeichnen. Auf einer durchschnittlichen Almweide finden mehr Pflanzenarten Lebensraum als in einem Wald. Das liegt vereinfacht gesagt auch daran, dass es in Österreich von Natur aus mehr Licht- als Schattenpflanzen gibt und ein geschlossener Wald den Boden großflächig beschattet. Auch Gehölzarten an sich kommen vergleichsweise wenige vor, selbst in einem sehr naturnahen Wald.
„Der wichtigste Grund für die heutige Artenarmut unter den Gehölzarten liegt in den Eiszeiten. Die haben nur wenige Arten durch den Rückzug in Refugien überstanden. Davor war die Gehölzflora Europas deutlich artenreicher.”
Zwar erfüllt der Wald wichtige und unersetzliche Funktionen, in Sachen Artenvielfalt kann er aber mit einer extensiv bewirtschafteten Almwiese nicht mithalten. Der Lebensraum der zahlreicheren Lichtpflanzen wurde durch die Schaffung der Almen vergrößert.
Bewirtschaftete Almen reduzieren das Lawinenrisiko
Unter alpinen Naturgefahren sind Ereignisse wie etwa Muren (Schlamm-/Gerölllawinen), Überflutungen oder Lawinen zu verstehen. Dabei kommen innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Wasser, Schnee, Erde, Fels oder Gestein einen Abhang herunter. Den besten Schutz davor bieten Schutzwälder.
Aber auch gut geführte Almweiden mindern das Risiko für bestimmte Naturgefahren. Das liegt vor allem daran, dass Gras ohne Beweidung oder Mahd zu langen Halmen heranwächst. Je nach Bedingungen können sie sich unter Schneelast beugen und so zu einer Rutschfläche formen. Auf nicht beweideten oder gemähten Flächen in Hanglage erhöht sich dadurch für eine Übergangszeit die Intensität des sogenannten Schneegleitens. Ähnlich wie die Eismassen eines Gletschers langsam Richtung Tal fließen, gleitet auch eine Schneedecke als Ganzes ganz allmählich hangabwärts. Je nach Standort und Witterungsbedingungen kann die herabgleitende Schneedecke brechen und dadurch Lawinen auslösen.
Auch sommerliche Überflutungen weiter talwärts können durch brachliegende Almflächen begünstigt werden. Nicht gemähte oder abgefressene Grashalme sterben nämlich am Ende jeder Vegetationsperiode naturgemäß ab. Da sie im kühlen Bergklima nur langsam verrotten, können bestimmte Grasarten im Laufe der Jahre robuste Filzmatten bilden, durch die Wasser nur schwer versickern kann. „Bei einem Starkregen wirkt der Filz wie ein Strohdach, von dem die Tropfen abperlen. Das Wasser fließt vermehrt oberflächlich ab, statt im Boden zu versickern“, erklärt Naturgefahren-Experte Gerhard Markart vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW). Das Problem dabei: Je mehr Wasser innerhalb kurzer Zeit vom Himmel fällt und nicht im Boden versickert, desto eher führt es weiter talwärts zu lokalen Überschwemmungen und Erosion.
Starkregenereignisse sind in Österreich wegen des Klimawandels schon jetzt häufiger zu beobachten. Sie können selbst an kleinsten Bächen innerhalb kürzester Zeit zu verheerenden Überschwemmungen führen. Das gilt besonders für den Alpenraum, wo das Niederschlagswasser weiter Einzugsgebiete in relativ engen Talmulden zusammenläuft. Laut Experte Gerhard Markart macht man es sich aber zu einfach, wenn man die entstehenden Schäden allein dem Klimawandel zuschreibt. Auch Änderungen bei der Landnutzung hätten in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass die Landschaft immer weniger Wasser zurückhalten kann. Dazu gehörten neben der Versiegelung der Landschaft auch die Auflassung von Almen.