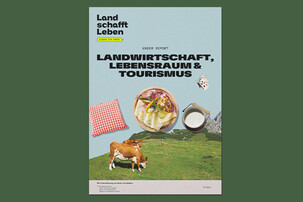Warum Draußen-Sein gut für uns ist
Dass Bewegung gesund und förderlich für Körper und Geist ist, gehört mittlerweile zum Allgemeinwissen. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Wissenschaft zudem zahlreiche Hinweise für die wohltuende Wirkung ländlicher, oft als „natürlich“ bezeichneter Umgebungen gefunden. Im Grünen spazieren zu können, dürfte in Zeiten zunehmender globaler Verstädterung sogar noch an Bedeutung gewinnen.

Die Suche nach Erholung und „Stressabbau“ trieb schon an der Schwelle zum 19. Jahrhundert Menschen von den Städten in deren ländliche Umgebung. Um sich in der von Bäuerinnen und Bauern geformten Kulturlandschaft besser zurechtfinden zu können, veröffentlichte der in Krems geborene Franz de Paula Gaheis ab 1797 neun „Bändchen“ seiner „Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien“. Darin fragte er: „Wer wird sich wohl nicht auch zuweilen seiner Geschäfte entledigt und dem Stadtgetümmel entrissen wünschen, um die reinere Landluft zu geniessen, und in der Ruhe wieder Kräfte zu neuer Thätigkeit zu sammeln?“
Heute ist es wissenschaftlich bestätigt: Spaziergänge und körperliche Aktivität sind gesund. Der menschliche Körper ist dabei nicht nur für die Bewegung an sich, sondern auch für das Draußen-Sein geschaffen. Unsere viele hunderttausend Jahre dauernde Entwicklungsgeschichte als Jäger und Sammler war durch die Kombination aus beidem geprägt: Als „Steppenläufer“ durchstreiften unsere Vorfahren die afrikanische Savanne, um zu jagen und essbare Pflanzen zu sammeln. Ihr Leben bestand wesentlich aus Bewegung im Freien.
Am Land erholt es sich besser als in der Stadt
„Wir können schon davon ausgehen, dass der Aufenthalt im Grünen einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat“, sagt Landschaftsforscher Arne Arnberger von der BOKU. Er und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen mittels verschiedener Methoden die Effekte von Landschaften auf Menschen, die sie besuchen, bewohnen oder einfach nur betrachten. „“, stellt Arne Arnberger fest.
„Wenn wir mit Personen raus ins Grüne gehen und Messungen der mentalen Gesundheit machen, dann sehen wir nahezu immer positive Effekte”
Dass es ganz explizit der Aufenthalt im Grünen ist, der seine Wirkung entfaltet, zeigen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Bei einer Untersuchung, an der Arne Arnberger beteiligt war, wurden beispielsweise 44 Personen auf fünf unterschiedliche 45-minütige Spaziergänge geschickt. Vier führten durch jeweils verschiedene Kulturlandschaftstypen innerhalb des UNESCO-Biosphärenparks Wienerwald und einer über die Laxenburger Straße mitten in Wien.
Das Ergebnis der Befragungen war eindeutig: Fast alle Probandinnen und Probanden gaben an, sich in der Stadt „am wenigsten erholt“ zu haben. Die beste Erholungswirkung zeigte dagegen ein Spaziergang über eine Wiese, gefolgt von einem Waldspaziergang.
An erster Stelle stand die Wiese auch bei der Frage nach dem persönlichen Gefallen einer Landschaft, während die Stadt im Mittel „eher nicht bis überhaupt nicht“ gefallen hat. Auch bei anderen Parametern wie „Stressabbau“, „Wiederherstellung der Konzentrationsfähigkeit“ oder „Eignung zur Erholung“ belegte die Wiese den Spitzenplatz, während die Stadt als einziger Aufenthaltsraum durchgehend negativ bewertet wurde.
Kann ein Spaziergang im Grünen Depressionen lindern?

Auch die internationale Forschung liefert spannende Ergebnisse zu den unterschiedlichen Wirkungen eines Aufenthalts im Grünen verglichen mit der Stadt. Besonders relevant ist dies auch aufgrund der Tatsache, dass noch nie so viele Menschen in so großem Abstand zur „Natur“ beziehungsweise zu ländlichen Gegenden gelebt haben. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, wobei dieser Anteil bis 2050 voraussichtlich auf 70 Prozent anwachsen wird. In Österreich waren es laut der Datenwebseite Our World in Data im Jahr 2023 bereits 60 Prozent der Menschen, die in städtischen Gebieten lebten.
Diese fortschreitende globale Verstädterung geht einher mit einem erhöhten Maß an psychischen Erkrankungen, zu denen unter anderem Angststörungen und Depressionen zu zählen sind. Wodurch genau diese hervorgerufen werden, ist bislang weitgehend unbekannt. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass mehrere Ursachen eine Rolle spielen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung untersuchte ein Forschungsteam der berühmten Universität von Stanford in Kalifornien (USA) einen der möglichen Wirkmechanismen, genauer gesagt den Einfluss von Naturerfahrungen auf das Grübeln. Grübeln wird in der Studie als „schädliches Verhaltensmuster selbstbezogener Gedanken“ bezeichnet. Wer häufig in negativen Gedankenschleifen festhängt, sei es aus Sorge um den Arbeitsplatz oder die Gesundheit, aufgrund von Beziehungsproblemen oder anderem, trägt ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Ähnliches.
Das Standford-Team schickte 38 gesunde Versuchspersonen ohne mentale Auffälligkeiten auf je einen von zwei unterschiedlichen, 90 Minuten andauernden Spaziergängen.
Der „Naturspaziergang“ führte in einer rund fünf Kilometer langen Schleife durch offenes Grünland mit verstreuten Eichen und Sträuchern, weitgehend entfernt von Straßen- und Stadtlärm. Der Routenverlauf bot Ausblicke auf umliegende Hügel sowie die entfernt liegende Bucht von San Francisco.
Der „Stadtspaziergang“ führte die Probandinnen und Probanden hingegen auf gleicher Distanz entlang einer Hauptverkehrsstraße von Palo Alto mit drei bis vier Fahrbahnen in beiden Richtungen und hohem Verkehrsaufkommen.
Das Ergebnis der Studie[i] wurde 2015 im renommierten US-amerikanischen Wissenschafts-Journal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) veröffentlicht. Anhand spezieller, von den Versuchspersonen ausgefüllter Fragebögen zeigte sich ein deutlicher Rückgang des Grübelns nach dem Naturspaziergang. Sogar noch stärker konnte der Effekt anhand von Gehirn-Scans gemessen werden. Sie zeigten eine erheblich geringere Durchblutung jenes Hirnbereichs, der während des Grübelns aktiv ist.
Da wiederholtes Grübeln, wie erwähnt, mit einem erhöhten Risiko von psychischen Erkrankungen einhergeht, bestärkt das Experiment aus wissenschaftlicher Sicht die zuvor gehegte Vermutung: Mangelnder Zugang zu naturnahen Gegenden und offenen Landschaften scheint das Risiko für Depressionen und andere mentale Leiden zu vergrößern.
Die Aufmerksamkeits-Erholungs-Theorie
Aber was genau macht den Aufenthalt im Grünen so erholsam? Antworten liefert die innerhalb der Wissenschaft viel zitierte sogenannte Aufmerksamkeits-Erholungs-Theorie (engl.: Attention Restoration Theory, ART). Sie wurde vom Psychologen-Ehepaar Rachel und Stephen Kaplan Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre aufgestellt. Bereits zuvor war man in der Psychologie davon ausgegangen, dass es zwei verschiedene Arten von Aufmerksamkeit gibt.
Bei der gerichteten Aufmerksamkeit konzentriert sich der Mensch bewusst und willentlich auf eine bestimmte Aufgabe beziehungsweise einen Reiz, wie etwa beim Lernen oder Arbeiten. Da die Konzentrationsfähigkeit des Gehirns aber begrenzt ist, wirkt die gerichtete Aufmerksamkeit mit der Zeit ermüdend, man wird leichter ablenkbar und neigt zu Reizbarkeit. Als beispielhafte Situation, in der ein Zustand der Aufmerksamkeitsermüdung eintreten kann, wird häufig das Ausfüllen der Steuererklärung genannt, während im Hintergrund die eigenen Kinder zu hören sind, die im Garten spielen.
Ganz anders bei der ungerichteten Aufmerksamkeit, auch als Faszination bezeichnet. In diesem Zustand widmen wir uns einer Sache automatisch und mühelos, es bedarf keiner willentlichen Konzentrations-Anstrengung. Stattdessen werden wir wie von selbst in etwas „hineingezogen“, während unser Gehirn sich erholen und gewissermaßen seine „Akkus“ wieder aufladen kann.
Laut der Theorie der Kaplans wird der Zustand der ungerichteten Aufmerksamkeit durch naturnahe Umgebungen stark begünstigt. Rachel Kaplan fand in einer eigenen Studie zum Beispiel heraus, dass in einem Büro arbeitende Menschen ihren Beruf mehr mochten sowie gesünder und zufriedener waren, wenn sie durch das Bürofenster eine Aussicht ins Grüne hatten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Begriff „Natur“ in vielen Studien nicht näher definiert beziehungsweise mit „Landschaft“ gleichgesetzt wurde. Eine gänzlich natürliche Landschaft, in die der Mensch nicht eingreift, würde an vielen Orten Österreichs aus dichten, schwer zugänglichen Wäldern bestehen, in denen sich Menschen weniger wohl und sicher fühlen als in halboffenen Landschaften. Daher wirken traditionelle, kleinteilige Kulturlandschaften mit einem Mix aus bewirtschafteten Wäldern und von der Landwirtschaft genutzten Wiesen, Weiden, Äckern, Weinbergen und anderem besonders entspannend und erholsam.